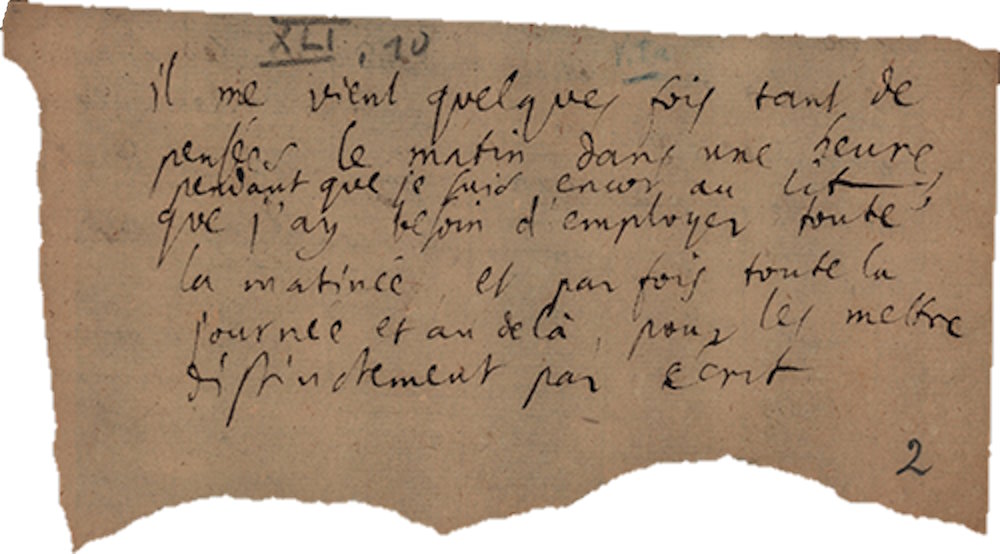Mathematischer Ort des Monats Oktober 2025
Grafitti zu Johannes Kepler und Gottfried Wilhelm Leibniz im
Potsdamer Ortsteil Am Stern
von
Wolfgang Volk
Der Potsdamer Ortsteil Am Stern liegt im (Süd-)Osten des Stadtgebiets und wird im
Osten durch die Autobahn A115 und im Süden durch die Nuthe-Schnellstraße begrenzt.
Seinen Namen hat er vom nur wenig östlich gelegenen runden Platz, auf den (heute) 8 (zum Teil
ausgebaute) Verkehrswege sternförmig führen.
An diesem Rondell befindet sich auch das während der Regentschaft des Soldatenkönigs
Friedrich Wilhelm I.
(1688-1740) in Gestalt eines holländischen Bürgerhauses erbaute
Jagdschloss Stern1).
Der Johnnes-Kepler-Platz mit seinen Geschäften und Einrichtungen bildet das
Zentrum des Wohngebiets „Am Stern“ [3]. Auffällig ist zudem, dass östlich
des Johannes-Kepler-Platzes zahlreiche Straßennamen nach Astronomen und Mathematikern
benannt sind (Galileistraße, Gaußstraße, Grotrianstraße,
Laplacering, Leibnizring, Newtonstraße, Schwarzschildstraße). Aber auch
(Astro-)Physiker werden gewürdigt (Niels-Bohr-Ring, Max-Born-Straße, Otto-Hahn-Ring),
wie auch der russische Raketenpionier Konstantin E. Ziolkowski (mit der Ziolkowskistraße).
Am Johannes-Kepler-Platz befindet sich auch eine Zweigstelle der
Stadt- und
Landesbibliothek2). An der dem Johannes-Kepler-Platz
abgewandten Seite des alleinstehenden Gebäudes, an der sich lediglich eine Tür und
ein Fenster befinden – also recht viel Wandfläche bietet, befindet sich das oben
wiedergegebene Grafitto, das naheliegenderweise den Hofmathematiker des Kaisers
Rudolph II. (1552-1612)
Johannes Kepler (1571-1630)
würdigt. Es zeigt den Namen „Kepler“ Ton in Ton mit dem Bildhintergrund in
großen Lettern. Deren Höhe stimmt mit jener des Grafittos überein, weshalb
der Name nicht vordergründig auffällt. Am linken Rand des Grafittos erkennt man den Rand der
brodelnden Sonne und nach rechts, in der korrekten Reihenfolge bezüglich wachsender
Abstände von der Sonne, Darstellungen der Planeten
Merkur, Venus, der Erde, Mars, Jupiter, Saturn – erkennbar an seinem ausgeprägten
Ringsystem –, Uranus mit einem angedeuteten Ring, der fast senkrecht zur Bahnebene
steht und entsprechend wiedergegeben ist, Neptun und Pluto. Daneben zieht sich ein Band
aufgeschlagener Bücher durch das Bild. Der Eindruck eines Bandes wird durch eine Kette von
Bildpunkten, die durchaus auch Sterne (ähnlich der Milchstraße) darstellen könnten,
vestärkt.
Einen Bezug zu den Büchern findet man im Schriftzug „Astronomia Nova“ in der
rechten oberen Ecke des Grafittos. Dieser ist gerade der Titel des Buches, das Johannes Kepler 1609
(selbstverständlich in lateinischer Sprache) veröffentlichte.
(Mit [1] liegt dieses Werk auch in deutscher Sprache vor.)
In diesem Buch sind die ersten beiden Gesetze der Planetenbewegung ausformuliert, die heutzutage
Kepler'sche Gesetze genannt werden.
1. Kepler'sches Gesetz: Die Bahn eines jeden Planeten ist eine Ellipse,
wobei die Sonne in einem der beiden Brennpunkte steht.
2. Kepler'sches Gesetz: Ein von der Sonne zum Planeten gezogener Fahrstrahl
überstreicht in gleichgroßen Zeitintervallen gleich große Flächen.
Ein drittes Gesetz fand J. Kepler erst im Jahr 1618, er hat es in seinem Buch Harmonices Mundi
Libri V, das im Jahr darauf erschien, ausformuliert.
3. Kepler'sches Gesetz: Das Verhältnis des Quadrats der Umlaufzeit eines Planeten
zur dritten Potenz der großen Halbachse seiner Bahnellipse ist für alle Planeten
dasselbe.3)
Das revolutionär neue an Keplers Überlegungen war, dass man zuvor versuchte,
die Unregelmäßigkeiten der Planetenbewegungen mit Hilfe von Epizykeln zu erklären,
also einer Kreisbahn, die sich selbst auf einer Kreisbahn um die Sonne bewegt. Selbst
Nikolaus Kopernikus4)
(1473-1543) hat diesen Ansatz seinen Betrachtungen noch zugrundegelegt.
Durch den von ihm vorgeschlagenen Übergang zum heliozentrischen Weltbild, war für
Johannes Kepler offensichtlich, dass der Planet Erde seine Vorrangsstellung verloren hat und eine
exakt kreisförmige Bahn auch für die Erde nicht mehr vorausgesetzt werden kann.
Das Grafitto „Stern-Garten“
Unmittelbar am nördlich vom Bibliotheksbau gelegenen Nachbargebäude –
der Abstand beträgt nur wenige Meter – ist die Wand mit einem neueren Grafitto
mit ähnlicher Thematik verziert; allerdings fehlt hier der unmittelbare Bezug zu
Johannes Kepler. Während im Vordergrund ein Gartenidyll mit mehreren Wasserspielen,
die von zahlreichen Vögeln als Tränke genutzt werden, zu erkennen ist,
ist der Hintergrund als Mosaik mit einer Wiedergabe der Sonne und den (verblebenen) 8 Planeten
gestaltet. Bekanntermaßen hat die Internationale Astronomische Union (IAU) in einer
Abstimmung im August 2006 dem 1930 entdeckten Planeten Pluto den Planetenstatus aberkannt.
Während auf dem Grafitto am Bibliotheksgebäude Pluto noch wiedergegeben ist,
fehlt er bei dem mit „Stern-Garten“ betitelten Werk.
Das Grafitto „Stern-Garten“ wird nachstehend als Bildfolge wiedergegeben,
wobei sie am rechten Ende (aus Sicht des Betrachters) mit dem Zentralgestirn, der Sonne,
beginnt und in der Folge nach links mit wachsendem Abstand die Planeten wiedergegeben
werden. Zwar wird hier der Planet Uranus ebenfalls mit einem eher unauffälligen Ring
dargestellt, dessen extreme Neigung zur Bahnebene aber nur sehr moderat angedeutet ist.
Im Bereich des Johannes-Kepler-Platzes gibt es seit 1980 noch ein weiteres Kunstwerk,
das sich im weiterem Sinne der Thematik Weltraum widmet, es trägt die Bezeichnung
„Schwebendes Paar“ und stammt von Karl und Bruno Raetsch.
Es sei hier allerdings nur darauf hingewiesen, eine Beschreibung findet man in [2, Kunstwerk 39].
Das Grafitto am Leibniz-Gymnasium
Nur durch einen kleinen Baumbestand und dem nördlichen Teil der Newtonstraße von
den beiden weiter oben beschriebenen Grafitti getrennt befindet sich das Areal des
(örtlichen) Leibniz-Gymnasiums. Dessen südwestliche Ecke ist in Gestalt einer massiven
Mauer ausgestaltet, die mit einem Grafitto, das im Wesentlichen den Namen der Bildungsanstalt
ausweist, versehen ist.
Es gibt allerdings zwei Details auf die gesondert hingewiesen werden soll. Da ist zum einen
ein Porträt des Namensgebers und Universalgelehrten
Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646-1716), der sich auch mit mathematischen Themen maßgeblich beschäftigt hat,
in das Grafitto integriert und das nachstehend separat wiedergegeben wird.
Bei genauerem Hinschauen erkennt man zum anderen, dass das Wort „Gymnarum“ noch mit
mit einem Text in Schreibmaschinenschrift überlagert ist. Dieser Text lautet wie folgt:
Beim Erwachen hatte ich schon
so viele Einfälle, dass der Tag nicht ausreichte, um sie niederzuschreiben.
Dies ist eine aus dem Französischen frei übersetzte Notiz von G. W. Leibniz
(siehe nachstehendes Fragment).
Referenzen
| [1] | Johannes Kepler: Astronomia Nova – Neue ursächlich begründete Astronomie, übersetzt von Max Caspar, durchgesehen und ergänzt sowie mit Glossar und einer Einleitung versehen und herausgegeben von Fritz Krafft, matrixverlag, Wiesbaden, 2005 | |
| [2] | Landeshauptstadt Potsdam – FB Kultur und Museum, FB Grün- und Verkehrsflächen (Hrsg.): Kunst im öffentlichen Raum – Babelsberg / Schlaatz / Waldstadt / Am Stern / Drewitz / Kirchsteigfeld, Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH, mit einem Vorwort von Dirk Alexander Schermer | |
| [3] | PotsdamWiki: Wohngebiet „Am Stern“, zuletzt bearbeitet am 3. August 2024 |
Bildnachweis
| Grafitti zu Johannes Kepler und zum Leibniz-Gymnasium | Wolfgang Volk, Dezember 2014 | |
| Grafitto Stern-Garten | Wolfgang Volk, September 2025 | |
| Notiz | Von der Homepage der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) kopiertes und nachträglich für die obegen Zwecke bearbeitetes Bild. Bekanntlich ist G. W. Leibniz 1716 verstorben, was bereits länger als 70 Jahre her ist (siehe § 64 Urheberrechtsgesetz [UrhG]). Ferner werden gem&aum;ß der Leitlinien zur Lizenzierung von wissenschaftlichen Produkten der BBAW unter anderem für Bilder die Creative Commons Lizenz Attribution 4.0 (CC BY 4.0) angewendet. Diese ist sinngemäß auch auf diese Grafik anwendbar. |
1) Die Gegend um diesen Platz lag seinerzeit in einem
ausgedehnten Waldgebiet, der Parforceheide. Über die damalige Situation gibt ein
Plan von C. G.Tschirsky aus dem Jahr 1786 beredt Auskunft,
der von einer Informationstafel abgelichtet hinter dem Verweis/Link wiedergegeben ist.
„Der Stern“ ist etwa im Zentrum des rechten unteren Bildviertel zu erkennen,
oben links der südliche Teil der Stadt Potsdam.
2) Diese Zweigbibliothek ist derzeit (2025 und
voraussichtlich bis 2027) wegen umfangreicher Umbau- und Modernisierungsarbeiten
geschlossen; das alleinstehende Gebäude ist mit einem Bauzaum umgeben.
3) Dieses Gesetz wird nun meist anders formuliert,
indem die Umlaufzeiten und großen Halbachsen der Bahnellipsen zweier Planeten
zueinander ins Verhältnis gesetzt werden.
4) Ob die korrekte latinisierte Schreibweise
des Namens „Nicolaus Copernicus“ lautet, wird immer noch diskutiert.
Im deutschen Sprachraum scheint sich die Schreibweise mit „K“ durchgesetzt zu
haben.