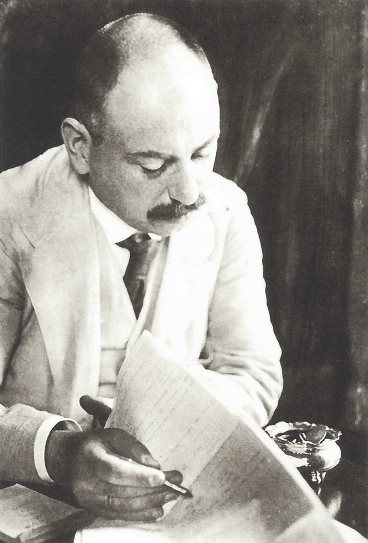Mathematiker des Monats November 2017
Edmund Georg Hermann Landau (1877-1938)
Edmund Landau erblickte am 14.2.1877 – ziemlich genau 100 Jahre nach
Carl Friedrich Gauß und
bis auf wenige Tage gleich mit
Godfrey Harold Hardy
(* 7.2.1877) – in Berlin das Licht der Welt.
Sein Vater, der Gynäkologe Dr. Leopold Landau, war zu der Zeit schon Dozent an der
Charité und wohnte mit seiner Frau Johanna,
geborene Jacoby, in der Schadowstraße 10-11 in dem Hause, das der berühmte
Bildhauer
Gottfried Schadow für
sich 1805 erbaut hatte.
Ab 1880 wohnte die Familie in der Französischen Straße 60 und ab 1888 in der
Dorotheenstraße 541).
Edmund Landau war das einzige Kind seiner Eltern.
Edmund Landau besuchte das
Französische Gymnasium, das am Ufer der Spree,
Reichstagsufer 6, ganz in der Nähe lag. (Heute steht dort das
Jakob-Kaiser-Haus des
Bundestages).
Bereits mit 16 Jahren legte er 1893 seine Abiturprüfung ab und studierte anschließend an der
Berliner Universität,
wo er Vorlesungen bei
Georg Frobenius,
Georg Hettner,
Ernst Steinitz,
Hermann Amandus Schwarz und
Lazarus Fuchs hörte,
unterbrochen von zwei Semestern an der Universität München.
Es hat sich von Landau eine sehr schöne und ausführliche Ausarbeitung
der Algebra-Vorlesung 1896/97 von Frobenius erhalten. 1899 promovierte er bei Frobenius,
wobei er (ebenso wie später
Issai Schur) sein Thema selbst gesucht hat.
Seine erste Veröffentlichung erschien 1895 in der Zeitschrift
Deutsches Wochenschach2)
mit dem Titel: „Zur relativen Wertbemessung der Turnierresultate“.
Den hier vorgelegten Algorithmus hat (sehr viel später)
Larry Page wieder gefunden, ihn bei der
Suchmaschine Google eingesetzt und ihn auch
patentieren lassen.3)
1901 habilitierte sich Landau an der Berliner Universität. In diesem Jahr zog die Familie
in das großelterliche Haus am Pariser Platz 6A, das sein Großvater
Ernst Jacoby 1861 vom Erbauer, dem Stadtrat und Zimmermeister
Carl August
Heinrich Sommer gekauft hatte.
1905 heiratete er Marianne Ehrlich, die jüngere der beiden Töchter von
Paul Ehrlich
(Nobelpreis
für Physiologie oder Medizin 1908) und
bezog mit ihr eine Wohnung in der Hardenbergstraße 13 (das Haus steht heute nicht mehr).
1909 bekam er den Ruf an die Georg-August-Universität in Göttingen als Nachfolger von
Hermann Minkowski.
Hier ließ er sich vom Berliner Architekten
Alfred Breslauer ein komfortables
Einfamilienhaus bauen (Herzberger Chaussee 48), und hier entfaltete Landau auch seine ungeheure
Betriebsamkeit.
Er begann bereits sehr früh am Morgen zu arbeiten, was häufig bis in den späten Abend
dauerte. Sein großer Schreibtisch war dann abends stets aufgeräumt und leer.
Seine Assistenten hatten kein leichtes Leben.
Peter Scherk schreibt in einem Brief:
„Landau was a marvellous technician and a murderous slave driver;
you could not imagine a better teacher.“
Seine Vorlesungen waren penibel genau vorbereitet. Der berühmte Landau-Stil findet sich
gedruckt zum ersten Male in seinem Buch Darstellung und Begründung einiger neuerer
Ergebnisse der Funktionentheorie [2]
und hat Ähnlichkeit zum
Tractatus von
Ludwig Wittgenstein,
der fast zeitgleich entstand. Allerdings gewichtet Wittgenstein seine Aussagen in logischer
Abhängigkeit, während Landau seine Sätze und Definitionen einfach durchnummerierte.
Landau wäre gerne nach Berlin zurückgekehrt, aber das verhinderte zunächst
Frobenius, der wenig von der analytischen Zahlentheorie hielt. Dass dieses Gebiet,
auch dank der Arbeiten von Landau einen großen Aufschwung erleben würde,
konnte sich Frobenius wohl nicht vorstellen.
1933 kam es zu dem von
Oswald Teichmüller
inszenierten Vorlesungsboykott und in dessen Verlauf Landau sich vorzeitig
(er war ja erst 56 Jahre alt) pensionieren ließ.
Er kehrte nach Berlin zurück und kaufte sich ein Haus in der Tannenbergallee 22A in Charlottenburg.
Seinen Sitz im Aufsichtsrat der Victoria Versicherung musste er aufgeben.
Im weiteren Verlauf der Nazi-Diktatur wurde er auch gezwungen, seine Victoria-Aktien zu verkaufen.
In dieser Zeit der – sozusagen – „inneren Emigration“ reiste er viel
(unter anderem nach Brüssel, Groningen, Cambridge). In Groningen schrieb er auch sein Buch
Einführung in die Differentialrechnung und Integralrechnung,
die 1934 im holländischen Verlag Noordhoff erschien [3].
Bücher jüdischer Autoren konnten damals in Deutschland nicht mehr erscheinen.
Es sei noch erwähnt, dass Landau in dieser Zeit mit
Hans Heilbronn und
Peter Scherk noch einen bemerkenswerten Satz über die
Goldbachsche Vermutung
beweisen konnte:
Alle großen ganzen Zahlen lassen sich als Summe von
höchstens 71 Primzahlen darstellen.
Der große Satz von Winogradov
erschien nur knapp ein Jahr später.
Edmund Landau ist auf dem Jüdischen Friedhof im berliner Ortsteil
Weißensee bestattet (siehe
Mathematischer Ort des Monats August 2016).
Referenzen
| [1] | Wolfgang Kluge: Edmund Landau, sein Werk und sein Einfluss auf die Entwicklung der Mathematik, Staatsexamensarbeit, Universität Duisburg, 1983 | |
| [2] | Edmund Landau: Darstellung und Begründung einiger neuerer Ergebnisse der Funktionentheorie, Verlag Julius Springer, Berlin, 1916 | |
| [3] | Edmund Landau: Einführung in die Differentialrechnung und Integralrechnung, Verlag Noordhoff, Groningen usw., 1934 | |
| [4] | Edmund Landau: Collected Works, vol.1-9, Hrsg.: Leonid Mirsky, Isaac Jacob Schoenberg, Wolfgang Schwarz, Heinrich Wefelscheid et al., Thales-Verlag, Essen, 1985 ff |
Bildnachweis
| Porträt | Photo von E. Reichelt (Breslau) 1913, aus der Sammlung Wefelscheid | |
| Tafel | Wolfgang Volk, Berlin, entnommen aus Tafeln zu Mathematikern in Göttingen |
1) Dieses Haus steht heute noch und wird vom Bundestag genutzt.
Es ist das einzige alte Haus in der Dorotheenstraße, das zwischen Wilhelm- und
Ebertstraße liegt, es besitzt heute die Hausnummer 99.
2) Diese Wochenzeitschrift erschien zwischen 1875 und 1925
(siehe Schachmuseum –
Zeitschriften und Jahrbücher).
3)
Günter M. Ziegler
machte mich freundlicherweise hierauf aufmerksam.