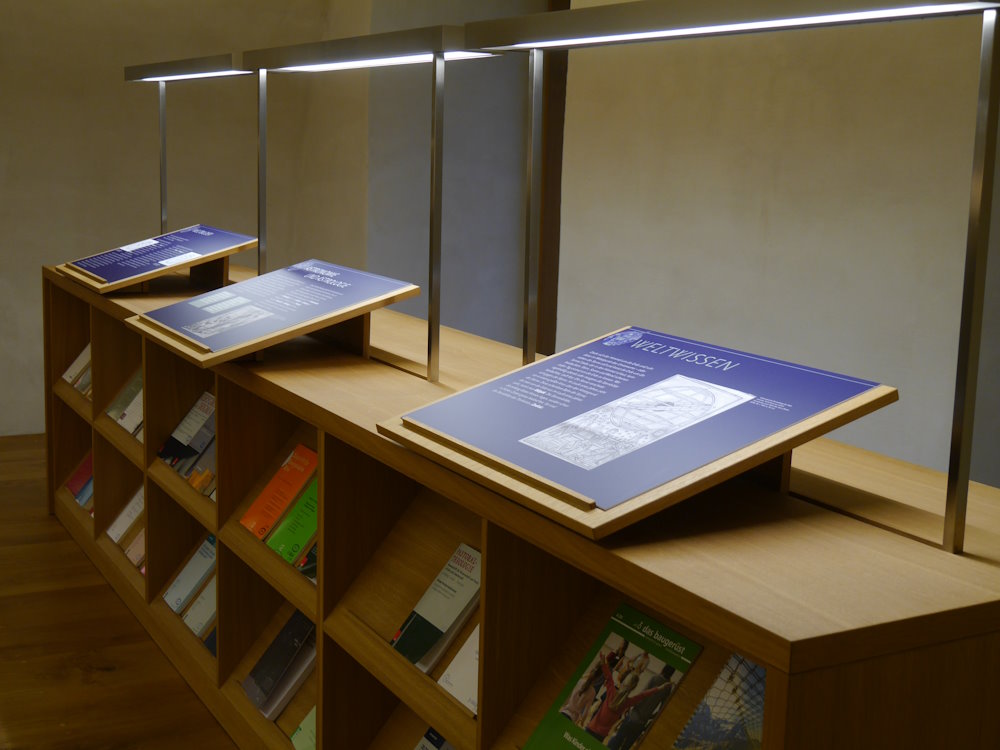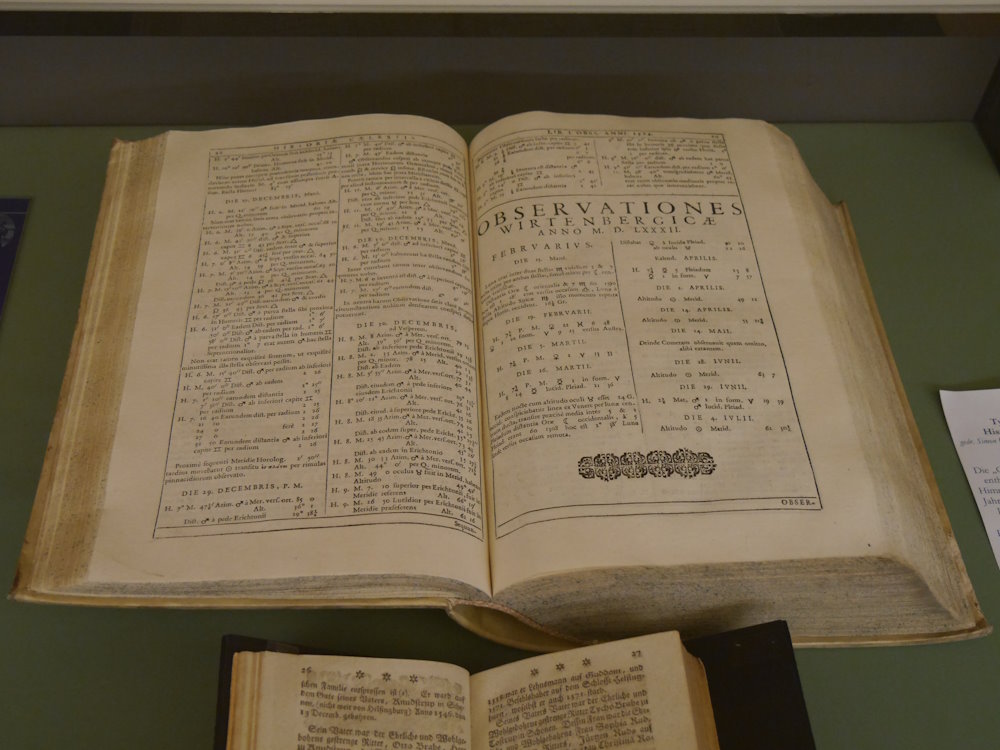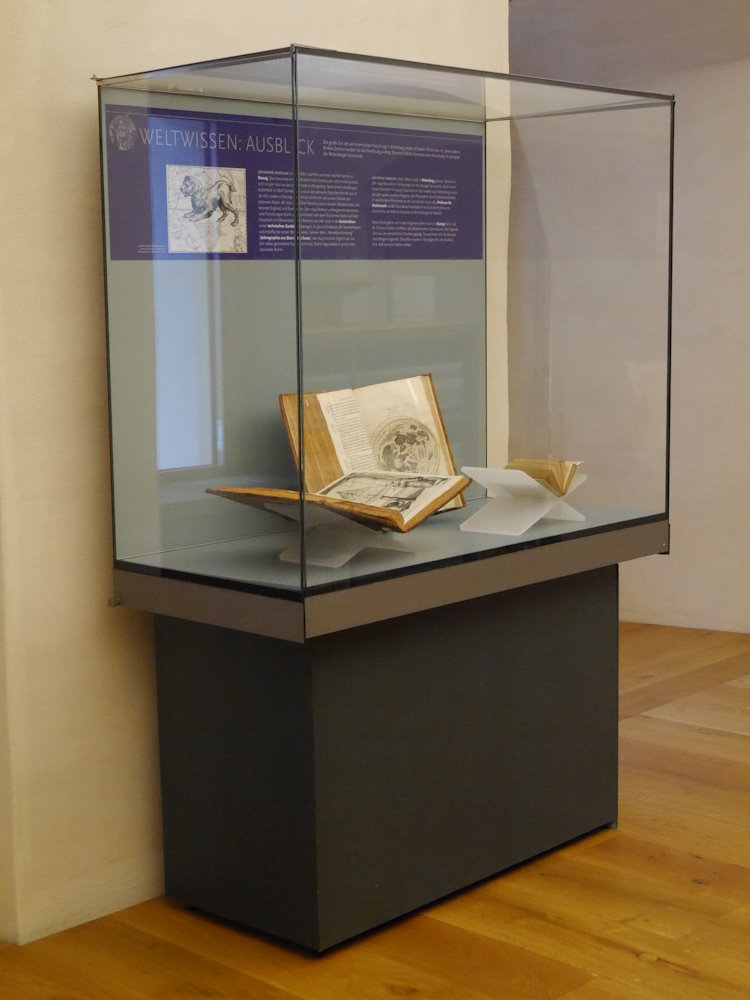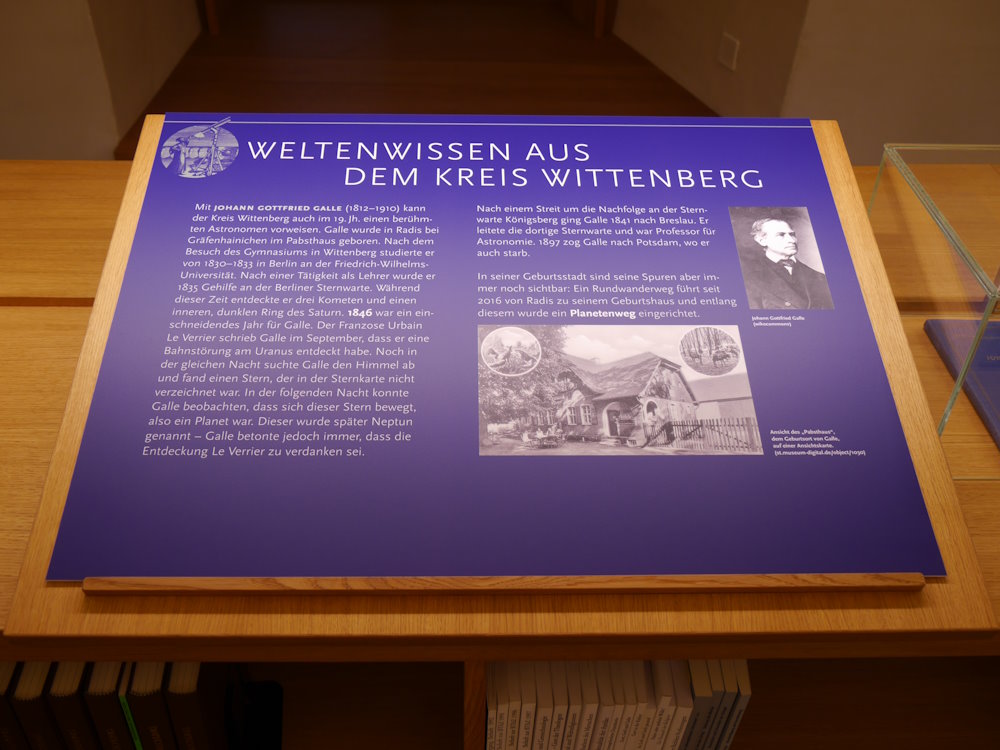Mathematischer Ort des Monats Februar 2025
Ausstellung Georg Joachim Rheticus (1514‒1574) und
die astronomische Forschung in Wittenberg
von
Wolfgang Volk
Im Zeitraum vom 7. Januar bis zum 25. März 2025 ist in den Räumlichkeiten der
Reformationsgeschichtlichen Forschungsbibliothek
Wittenberg, die im dritten Obergeschoss des Schlosses untergebracht
ist1), die Kabinettausstellung „WeltWissen
Wittenberg – Wittenberger WissensWelten“ zu sehen.
Dieser Titel der Ausstellung könnte besser für eine ganze Serie von Ausstellungen
stehen; um was es hierbei konkret geht, wird erst mit dem Untertitel „Georg Joachim Rheticus
(1514–1574) und die astronomische Forschung in Wittenberg“ deutlich.
Die Ausstellung korreliert mit der 450. Wiederkehr des Todestags von
Georg Joachim Rheticus am
4. Dezember 1574.
Die Reformationsgeschichtliche Forschungsbibliothek (RFB) ist eine öffentlich
zugängliche und interdisziplimär ausgerichtete Studienstätte für die
Erforschung von Geschichte und Kultur der Reformation am zentralen Wirkungsort Martin Luthers.
Gebildet wurde die Forschungsbibliothek im Frühjahr 2018 aus den Bibliotheken des
Evangelischen Predigerseminars und des Lutherhauses Wittenberg. Organisiert ist sie als
Gesellschaft bürgerlichen Rechts, in der das Evangelische Predigerseminar Wittenberg,
die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, die Stiftung LEUCOREA und die
Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
zusammenarbeiten.2)
Zur Eröffnung der Ausstellung wurde vom Ministerpräsidenten des Landes
Sachsen-Anhalt, Dr. Reiner Haseloff das Werk „Nicolai Copernici Torinensis
De revolutionibus orbium coelestium, Libri VI, Norimbergae apud Ioh. Petreium,
Anno MDXLIII“3) als Faksimile-Nachdruck
überreicht, das man nun als zentalen Teil der Ausstellung betrachten darf.
Warum dies der Fall ist, wird der nachfolgende Erzählstrang der Ausstellung verdeutlichen.
G. J. Rheticus wird am 16. Februar 1514 als Georg Joachim Iserin in Feldkirch
(heute im österreichischen Bundesland Vorarlberg) geboren. Nach der Hinrichtung seines
wegen Hexerei angeklagten Vaters nimmt seine aus Italien stammende Mutter wieder ihren (adligen)
Geburtsnamen de Porris und er – selbigen ins Deutsche übertragen –
von Lauchen an. Die spätere Benennung „Rheticus“ folgt der Mode der
Latinisierung von Eigennamen und bezieht sich auf die geografische Lage seines Geburtsorts
in der früheren Provinz des Römischen Reichs, Raetia.
Er studierte in Zürich und an der 1502 gegründeten Universität in Wittenberg
und erwarb hier 1536 den akademischen Grad
Magister artium. Ab dem Folgejahr
hatte er die Professur für Niedere Mathematik an der Wittenberger Universität inne.
Die ersten drei Texttafeln der Ausstellung thematisieren die scheinbaren Bewegungen der
Himmelskörper, die Entwicklung der Differenzierung von Astronomie und Astrologie,
die anfangs eher marginal erscheint, und die beiden Weltbilder – geozentrisch
versus heliozentrisch –, wobei auch deren bekanntesten Vertreter aus der Antike,
Aristoteles (384-322 vor Christus) und
Claudius Ptolemäus
(um 100-nach 160) sowie
Aristarchos von Samos
(um 310-um 230 v. Chr.) und
Seleukos von Seleukeia
(* um 190 v. Chr.) genannt werden.
Bis auf eine Ausnahme beziehen sich die weiteren Texttafeln auf die Bücher, die in den
darunter befindlichen Vitrinen ausgestellt sind. Die Themen werden hier nur grob skizziert,
aber die Protagonisten genannt. Auffallend ist, dass etliche Exemplare der ausgestellten
Bücher in Wittenberg gedruckt wurden.
Beim Thema „Antike“ wird ausschließlich Claudius Ptolemäus genannt.
Das ausgestellte Exemplar seines Hauptwerks in griechischer Sprache „Megalé
sýntaxés“ besitzt einen Ledereinband mit dem Hinweis auf Wittenberg
und der Jahreszahl 1561. Dieses Werk ist in lateinischer Übersetzung unter dem aus dem
Arabischen abgeleiteten Begriff Almagest bekannt.
Bezüglich des Mittelalters fokussiert die Ausstellung auf den englischen Mathematiker
und Astronomen
Johannes de Sacro
Busto4) (um 1195-1256), dessen Werk
„Tractatus de Sphaera“5) in einer Ausgabe
aus dem Jahr 1515 ausgestellt ist. Zudem wird ein Exemplar von Thomas Blebelius,
das offenbar das vorgenannte Buch kommentiert und 1595 in Wittenberg gedruckt wurde,
präsentiert.
Beim „Übergang zur Renaissance“ werden die Protagonisten
Georg von Peuerbach (1423-1461)
und dessen Schüler
Johannes Regiomontanus (1436-1476)
genannt – aber auch der byzantinische Theologe und Philosoph
Bessarion (um 1400-1472) wird erwähnt.
Bereits zu dieser Zeit hatte man den Bedarf einer Kalenderreform erkannt,
da sich der Sonnenlauf erkennbar vom Julianischen Kalender entfernt hatte.
Auch Exemplare der Werke von G. von Peuerbach und J. Regiomontanus sind in der Ausstellung
zu sehen.
Die beiden nächsten Texttafeln sind G. J. Rheticus und
Nikolaus Kopernikus (1473-1543)
und deren Zusammenwirken bezüglich des Drucklegung des oben genannten Werks
„De revolutionibus orbium coelestium“ gewidmet. In diesem Zusammenhang wird auch
unter anderem Rheticus' Lehrer
Johannes Volmar
(?-1536), der ab 1519 die Professur für Mathematik und ab 1525 jene für Höhere
Mathematik an der Universität in Wittenberg inne hatte, genannt.
Zu erwähnen ist auch das ausgestellte Buch von Clausius Ptolemäus
Mathematicae constructionis liber primus graece et latine, das vom
wittenberger Mathematikprofessor
Erasmus Reinhold (1511-1553,
siehe auch [9]) ins
Lateinische übersetzt und mit Anmerkungen versehen 1549 herausgegeben und in Wittenberg
gedruckt wurde. E. Reinhold wird auch auf einer nachfolgenden Texttafel gewürdigt.
In Bezug auf Astronomie und Mathematik werden auf weiteren Texttafeln noch folgende
Persönlichkeiten genannt:
-
Sebastian Theodoricus
(1521-1574)
Er war in Wittenberg ab 1550 zunächst Professor fü Niedere ab 1560 für Höhere Mathematik, wandte sich aber später der Medizin zu. -
Bartholomäus
Scultetus (1540-1614)
Er studierte zeitweise in Wittenberg die Sieben Freien Künste – unter anderem beim Professor für Höhere Mathematik Caspar Peuker (1525-1602) – konnte dort aber keine Anstellung finden und zog zurück nach Görlitz und wirkte dort als Mathematiklehrer am Gymnasium Augustum.
Just gegenüber der zuletzt beschriebenen Tafeln und Vitrinen ist eine separate Vitrine
platziert, die ausschließlich
Tycho Brahe (1546-1601) gewidmet ist.
Die Beschreibung weist unter anderem aus, dass Brahe auch in Wittenberg studiert hat und er das
Tychonisches Weltmodell
entwickelte, das einerseits die relativen Bewegungen der Sonne und ihrer Planeten gemäß
dem
Kopernikanischen Weltmodell
berücksichtigt, andererseits aber den Planeten Erde – wie beim
Ptolemäischen
Weltmodell – im Zentrum stehen lässt.
Diese Vitrine wird von einem Buch mit dem Titel „Historia Coelestis“ dominiert,
das 1666 von Simon Utzschneider in Augsburg gedruckt wurde und Aufzeichnungen von
Himmelsbeobachtungen von T. Brahe in den Jahren 1582-1592 und 1594-1601 notiert.
Die aufgeschlagenen Seiten des Buchs weisen die in Wittenberg im Jahr
1582 ermittelten Messergebnisse aus – und zwar über etwa ein halbes Jahr.
Dies bezeugt, dass die Beziehung von Tycho Brahe zu Wittenberg doch intensiver war,
als man gemeinhin annehmen könnte – [4] benennt lediglich das Jahr 1599,
in dem T. Brahe auf seiner Reise nach Prag in Wittenberg wohnte.
Eine letzte Vitrine, die örtlich von den anderen abgesetzt platziert ist, vermittelt in
gewisser Weise einen Abgesang auf die Hochzeit der astronomischen Forschung in Wittenberg.
Der ausgearbeitete Text verknüpft die Lebensläufe des Astronomen
Johannes Hevelius (1611-1687)
aus Danzig und des Mathematikprofessors
Aegidius Strauch (1632-1682)
aus Wittenberg, der seinen Lebensmittelpunkt später nach Danzig verlegte.
Zudem sind in dieser Vitrine drei von J. Hevelius, der bekanntermaßen die Kartografie
des Mondes begründete, verfasste Bücher ausgestellt,.
Ebenfalls örtlich etwas abgelegen enthält die Austellung eine speziell auf den
Astronomen
Johann Gottfried Galle
(1812-1910) fokussierte Texttafel. J. G. Galle wurde im Ort Radis im heutigen Landkreis
Wittenberg geboren. Er besuchte das Gymnasium in Wittenberg (siehe [6]).
Zudem studierte er in den Jahren 1830 bis 1833 an der Friedrich-Wilhelms-Universität
in Berlin und entdeckte 1846 an der berliner Sternwarte nach Berechnungen des französischen
Mathematikers
Urbain Le Verrier (1811-1877)
den Planeten Neptun. Diese Geschichte erzählt eine Tafel am (ehemaligen) Ort der Sternwarte
im Stadtbezirk Berlin-Kreuzberg [7].
Weitere Informationen zur Ausstellung – wie Öffnungszeiten und Termine
zu Sonderführungen durch die Ausstellung sind dem Flyer [1] zu entnehmen.
Es ist ausgesprochen imponierend, dass alle ausgestellten Bücher im Bestand dem
Reformationsgeschichtlichen Forschungsbibliothek Wittenberg entnommen sind und nicht auf
Leihgaben anderer Institutionen zurückgegriffen werden musste.
Referenzen
| [1] | Reformationsgeschichtliche Forschungsbibliothek: Flyer zur Ausstellung | |
| [2] | Reformationsgeschichtliche Forschungsbibliothek: Einladung zur Ausstellungseröffnung | |
| [3] | Reformationsgeschichtliche Forschungsbibliothek: Willkommen in der Reformationsgeschichtliche Forschungsbibliothek, Flyer | |
| [4] | Wolfgang Volk: Tafel zu Tycho Brahe in der Lutherstadt Wittenberg, Mathematischer Ort des Monats Mai 2024 | |
| [5] | Wolfgang Volk: Tafeln für Giordano Bruno, Joachim von Lauchen, Kaspar Peuker und Johann Daniel Titius in der Lutherstadt Wittenberg, Mathematischer Ort des Monats Oktober 2020 | |
| [6] | Wolfgang Volk: Tafel für Johann Gottfried Galle in der Lutherstadt Wittenberg, Mathematischer Ort in Vorbereitung | |
| [7] | Wolfgang Volk: Tafel für Johann Gottfried Galle und Urbain Jean Joseph Le Verrier in Berlin-Kreuzberg, Mathematischer Ort des Monats Oktober 2023 | |
| [8] | Wolfgang Volk: Tafel für Georg Joachim von Lauchen in der Lutherstadt Wittenberg, Mathematischer Ort des Monats April 2022 | |
| [9] | Wolfgang Volk: Tafel für Erasmus Reinhold in der Lutherstadt Wittenberg, Mathematischer Ort des Monats August 2021 |
Bildnachweis
| Alle Fotos | Wolfgang Volk, Berlin, Januar 2025 |
1) Der Zugang ist derzeit so geregelt,
dass man am Eingang im Schlosshof beim Besucherzentrum läuten muss, um eingelassen zu werden.
Von dort gelangt man mit dem Fahrstuhl zum dritten Obergeschoss.
2) Die Aussagen dieses Absatzes sind [3] wörtlich
entnommen.
3) Es ist das Buch von Nikolaus Kopernikus aus Thorn,
De revolutionibus
orbium coelestium (Über die Umlaufbahnen des Himmels),
das 1543 in Nürnberg bei Johannes Petreius gedruckt wurde.
4) Hier konsequent Sacro Busto (in zwei Worten)
statt Sacrobosco (ein Wort) genannt.
5) Hier ist das Werk schlicht als
„De Spaeris“ bezeichnet. Letztlich ist nicht auszuschließen,
dass bei den verschiedenen Buchausgaben nicht auch Übertragungsfehler und
(vermeintliche) Korrekturen eine Rolle spielen.