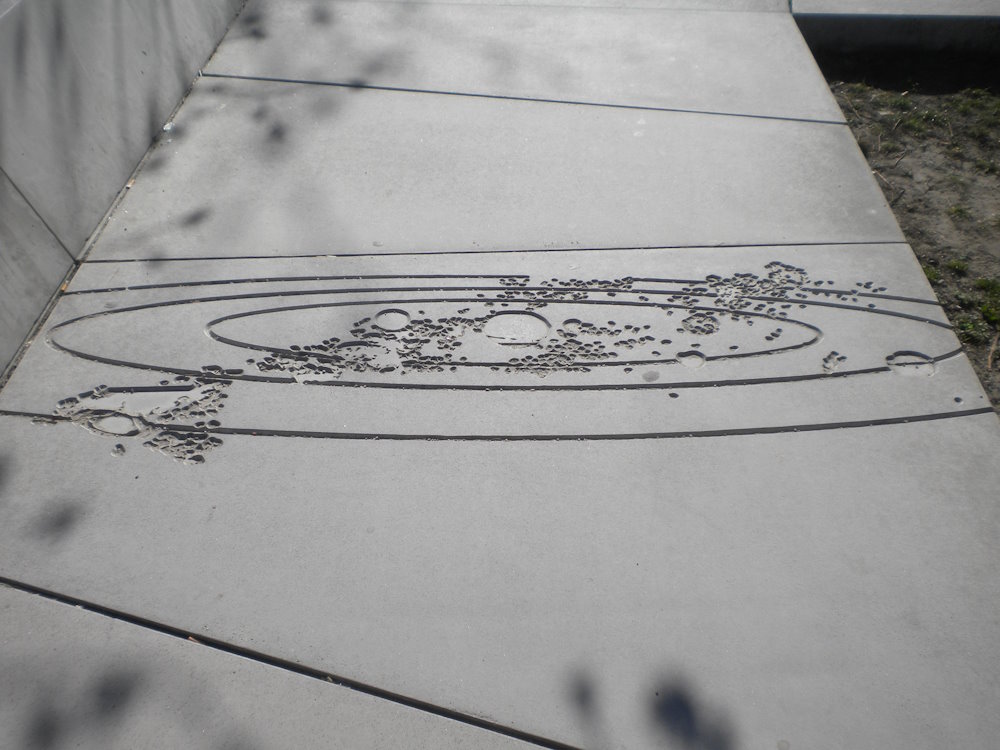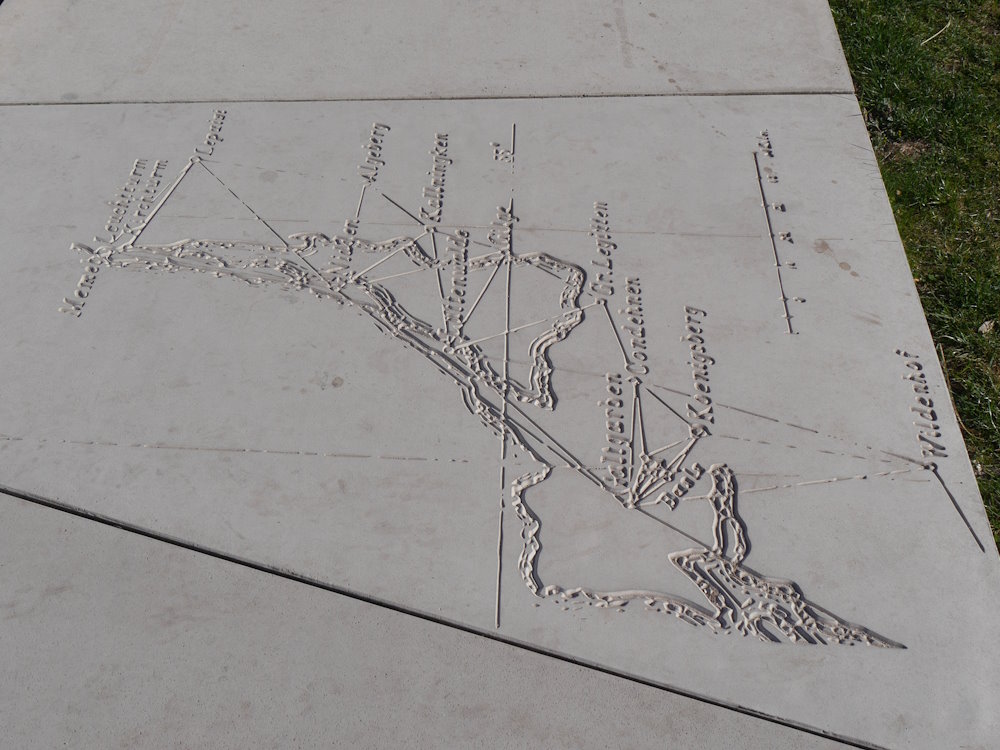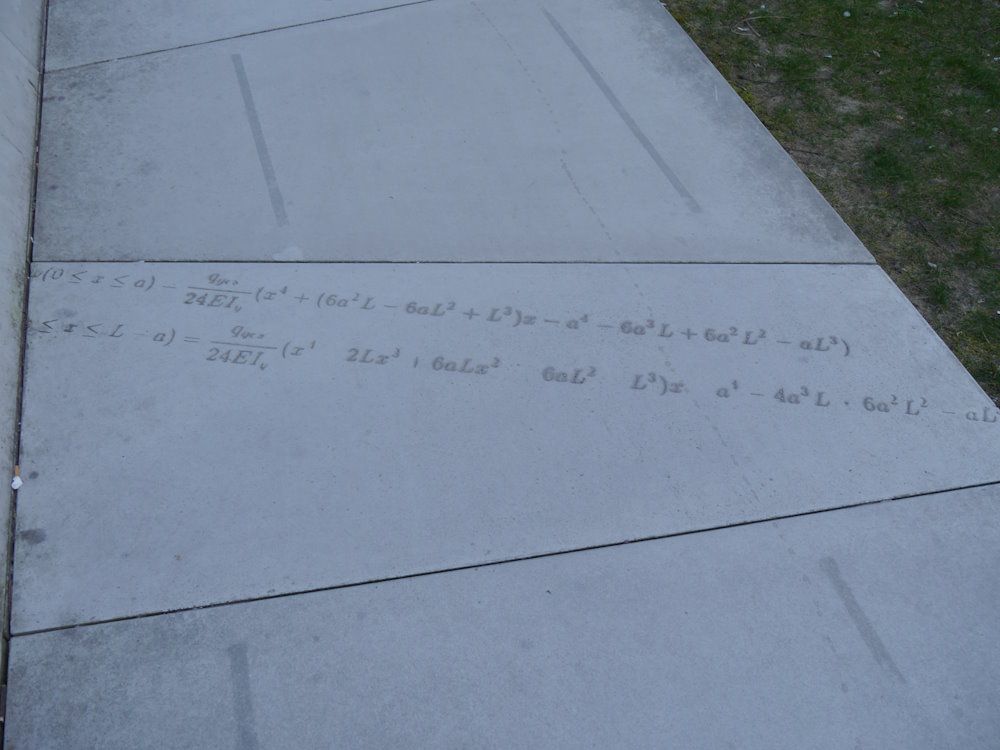Mathematischer Ort des Monats Februar 2024
Der Besselpark in Berlin-Kreuzberg
von
Wolfgang Volk
Der Besselpark wurde erst im Jahr 1995 als Parkanlage angelegt [7] und bestand im Wesentlichen
aus einer Grünfläche mit einem Baumbestand am nördlichen und am westlichen
Rand.1)
Seit dem Jahr 2011 zieht in der südwestlichen Ecke dieses Parks eine größere
metallne Skulptur des US-amerikanischen Künstlers
Fletcher Benton (1931-2019) die
Aufmerksamkeit auf sich. Jedoch müssen zwangsläufig alle Versuche scheitern, diese
Skulptur mit dem Namensgeber der Parkanlage, dem Astronomen
Friedrich Wilhelm Bessel
(1784-1846), oder der in den Jahren 1835 bis 1913 in der Nähe der südöstlichen Ecke
des Besselparks (heute Fromet-und-Moses-Mendelsohn-Platz) ansässigen
Berliner Sternwarte (siehe unter anderem [3] und [5]) in Beziehung zu bringen.
Dies wird einem gewahr, sobald man die Bezeichnung des Kunstwerks kennt:
Tilted Donut Wedge with Two Balls, auf deutsch „Gekippter
Donut2), Keil mit zwei
Kugeln“3)).
In den Jahren 2019-2020 wurde der Besselpark in dem Sinne „revitalisiert“ [2],
dass neue Wege angelegt wurden, welche es erlauben, das Arreal auch schräg beziehungsweise
diagonal zu durchqueren, aber auch Sitzgelegenheit bieten. Der Park erhielt durch diese
Maßnahme noch weitere Ausstattung, so im westlichen Teil – den Wunschbrunnen.
Die neuen Wege sind aus unregelmäßig geformten Betonplatten zusammengefügt,
die teilweise mit unterschiedlichen, eingravierten Motiven gestaltet sind, die ihrerseits eng mit
dem Namensgeber des Parks, Friedrich Wilhelm Bessel, in Beziehung stehen.
Betritt man den Besselpark aus südöstlicher Richtung – also vom
Fromet-und-Moses-Mendelsohn-Platz aus – dort, wo früher die Berliner
Sternwarte stand, so fällt als erstes ein Porträt von F. W. Bessel auf, das –
an dieser Stelle, die einzelnen Motive sind durchaus im Park mehrfach anzutreffen –
mit seinem Namen und seiner Unterschrift ergänzt ist.
Friedrich Wilhelm Bessel wurde am 22. Juli 1784 in Minden (Westfalen) geboren.
(Die wechselvolle Geschichte dieser Stadt ist in [9] nachzulesen.)
Sein Interesse für die Astronomie erwachte während seiner Ausbildung zum Kaufmann
in Bremen. Die hierfür zum Verständnis benötigten mathematischen Grundlagen
eignete er sich im Selbststudium an. Mit einer von
Franz Xaver von Zach angeregten
aber selbstständig erarbeiteten Bahnbestimmung des
Halleyschen Kometen erwarb er
1804 die Aufmerksamkeit des Bremer Arztes und Astronomen
Heinrich Wilhelm Olbers,
der ihm daraufhin eine Stellung an der privaten
Sternwarte Lilienthal von
Johann Hieronymus Schroeter
vermittelte. Im Jahr 1809 wurde Bessel als Professor für Astronomie an die
Universität Königsberg berufen und mit der Leitung der dortigen, zu errichtenden
Sternwarte betraut. An beiden Institutionen wirkte er bis zu seinem Tod im Jahr 1846.
Konsequenterweise sind auf den neu angelegten Wegen des Besselparks auch astronomisch inspirierte
Motive zu entdecken: so ein Sonnensystem mit Planeten,
wobei es eher unwahrscheinlich ist, dass zu Bessels Zeiten die Existenz von Exoplaneten
diskutiert wurde, sowie die Sternbilder Schwan und Leier des nördlichen
Sternhimmels.4)
Selbstverständlich stellt sich die Frage, warum ausgerechnt diese beiden Sternbilder hier
hervorgehoben werden. Für das Sternbild Leier (lateinisch: Lyra) lässt sich
das nicht separat beantworten – immerhin bilden die Hauptsterne Wega
(manchmal auch Vega, α Lyrae) und Deneb (α Cygnii), das heißt die
beiden hellsten Sterne der Sternbilder Leier und Schwan, zusammen mit dem hellsten
Stern Altair (gelegentlich auch Atair, α Aquilae) im Sternbild Adler
die auffällige – und damit bekannte – Sternenkonstellation des
„Sommerdreiecks“.
Allerdings hat das Sternbild Schwan im Zusammnhang mit F. W. Bessel noch eine besondere
Bedeutung: Mit dem eher unscheinbaren (Doppel-)Stern 61 Cygnii der Größenklasse 5
(dieser wird auch Bessels Stern genannt und fiel durch eine große Eigenbewegung
sowie einen vergleichbar großen Abstand der Doppelstern-Komponenten auf)
gelang es ihm erstmals aufgrund der Parallaxe, das heißt einer vergleichsweisen großen
scheinbaren Lageänderung innerhalb eines halben Jahres, an der sich unser Planet Erde an
diametralen Positionen seiner Umlaufbahn befindet, dessen Abstand zu unserem Sonnensystem
zu bestimmen – es sind etwa 11 Lichtjahre. Dieser Stern ist in der nachstehenden
grafischen Darstellung mit einen gelben Kreis links oberhalb des Zentrums optisch
hervorgehoben.
Als weiteres Gestaltungselement der neuen Wege im Besselpark ist eine Art Landkarte wiedergegeben.
Bei genauerer Betrachtung kann man den größten Teil der Küstenlinie Ostpreußns
mit dem Kurischen Haff und der gleichnamigen Nehrung erkennen. (Das dargestellte Gebiet gehört
heute teilweise zum Staat Litauen und teilweise zur Russischen Föderation.)
Ferner weist diese Darstellung das Dreiecksnetz der
Triangulation aus,
die im Rahmen der von Friedrich Wilhelm Bessel in den 1830er Jahren durchgführten
ostpreußischen Gradmessung angelegt wurde (siehe Tafel VII am Ende von [1]).
Das ursprüngliche Ziel dieser Vermessungsarbeiten war, die bereits bestehenden
Triangulationen in Preußen und dem Russischen Reich zu verbinden. Die Sternwarte in
Königsberg, deren Leitung F. W. Bessel innehatte, sollte in dieses Netz eingebunden
werden. Durch ergänzende astronomische Beobachtungen wurden die Arbeiten zu einer
Gradmessung ausgebaut (siehe auch die Ausführungen in [4]).
Ob es sich bei dem nachstehend abgebildeten Objekt um einen Sextanten oder um ein Heliotrop
handelt kann nicht zweifelsfrei entschieden werden.
Während seiner Ausbildung zum Kaufmann beschäftigte sich F. W. Bessel im Zusammenhang
mit dem Überseehandel auch mit Navigation. Da Navigationsinstrumente für ihn
in dieser Zeit unerschwinglich waren, baute er sich mit Unterstützung eines Tischlers und
eines Uhrmachers selbst einen
Sextanten. Möglicherweise zielt die
folgende Darstellung auf diese Episode ab.
Das Heliotrop5) hatte
Carl Friedrich Gauß
(1777-1855) im Zusammenhang mit der von ihm durchgeführten Vermessung des Königreichs
Hannover entwickelt, um bei der Winkelmessung6)
präziser die bei einer Triangulation weit entfernten Zielpunkte anvisieren zu können.
Hierfür hat er Sextanten derart umgebaut, so dass mit ihnen das Licht der Sonne zum
Beobachter, das heißt zum Standpunkt des
Theodoliten, umgelenkt werden konnte.
Die hellen Lichtpunkte waren über große Entfernungen gut zu beobachten.
F. W. Bessel machte bei der ostpreußischen Gradmessung ebenfalls von Heliotropen Gebrauch
[1].
Ein Formelpaar ist ebenfalls als ausgestaltendes Element der Wegplatten zu erkennen.
Diese stehen im Zusammenhang mit Bessels Untersuchungen zur Lagerung von Messstangen.
Man findet die Formeln in [8, Abschnitt „Biegelinie“]
Referenzen
| [1] | Friedrich Wilhelm Bessel: Gradmessung in Ostpreußen und ihre Verbindung mit Preußischen und Russischen Dreiecksketten, Berlin, 1838 | |
| [2] | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg: Besselpark – Übersicht | |
| [3] | Wolfgang Volk: Preußischer Normalhöhenpunkt 1879 in Berlin-Kreuzberg, mathematischer Ort des Monats September 2017 | |
| [4] | Wolfgang Volk: Denkmal für Johann Jacob Baeyer in Berlin-Müggelheim, mathematischer Ort des Monats Juni 2022 | |
| [5] | Wolfgang Volk: Tafel für Johann Gottfried Galle und Urbain Jean Joseph Le Verrier in Berlin-Kreuzberg, mathematischer Ort des Monats Oktober 2023 | |
| [6] | Wikipdia: Friedrich Wilhelm Bessel | |
| [7] | Wikipdia: Besselpark | |
| [8] | Wikipdia: Bessel-Punkt | |
| [9] | Wikipdia: Geschichte der Stadt Minden |
Bildnachweis
| Plastik „Tilted Donut Wedge with Two Balls“ | Wolfgang Volk, Berlin, September 2017 | |
| alle weiteren Fotos | Wolfgang Volk, Berlin, März – Mai 2022 | |
| Symbolbild mit den Sternbildern Leier und Schwan | erstellt mit der freien Software Stellarium |
1) Der Autor hat dieses Arreal seinerzeit eher als Brache
wahrgenommen.
2) „Donut“ wird üblicherweise mit
„Krapfen“ übersetzt. Charakteristisch ist jedoch seine torus-förmige
Gestalt.
3) Ob der Versuch, mit Interpunktion noch etwas zu
retten, gelungen ist, kann hier nicht abschließend bewertet werden.
4) Leider muss man aber konstatieren,
dass die Lage der beiden Sternbilder zueinander nicht korrekt wiedergegeben ist.
(vergleiche die synthetische Wiedergabe der Sternbilder).
5) Auf der Rückseite der 10-DM-Banknote,
die in den Jahren 1991-2002 von der Deutschen Bundesbank herausgegeben wurde,
ist ein Heliotrop abgebildet (siehe zum Beispiel diese
Banknote mit dem Porträt von
Carl Friedrich Gauß).
6) Mit einem Theodoliten misst man im eigentlichen
Sinne keine Winkel, sondern „beobachtet Richtungen“, indem man das Fadenkreuz des
(Ziel-)Fernrohrs auf den Zielpunkt einstellt und am eingebauten Teilkreis –
einer Art Winkelmesser, wie man sie vom Geometrie-Unterricht kennt – die Richtung
mit hoher Genauigkeit abliest. Der wesentliche Unterschied zu einem Winkelmesser ist der,
dass beim Teilkreis keine „Nullrichtung“ eingestellt wird. Winkelwerte werden
anschließnd durch Differenzbildung von Richtungen rechnerich ermittelt.